Landesvorsitzender Schleswig-Holstein
Seit September 2022
Spitzenkandidat für die Europawahl 2024
Für Frischen Wind im Europaparlament
Althistoriker aus Interesse und Leidenschaft
Uni Kiel
Aktuelles

Für ein starkes Europa! Überall und auch nach 2024!
Die Europawahl 2024 ist seit Monaten vorüber und die Bundestagswahl 2025 wirft bereits ihre Schatten[…]

2025: Schleswig-Holstein, die Zukunft und ich
In meinem letzten Beitrag hatte ich noch gesagt, dass meine Zeit als Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein[…]

Zukunft nach der Europawahl 2024? Mal sehen…
Heute ist der 02. September 2024. Die Europawahl liegt mittlerweile fast drei Monate zurück, aber[…]

Aufstehen für die Demokratie! 14.01.2024
Die Enthüllungen von Correctiv zu den Plänen der AfD und anderer rechter Kräfte haben es[…]
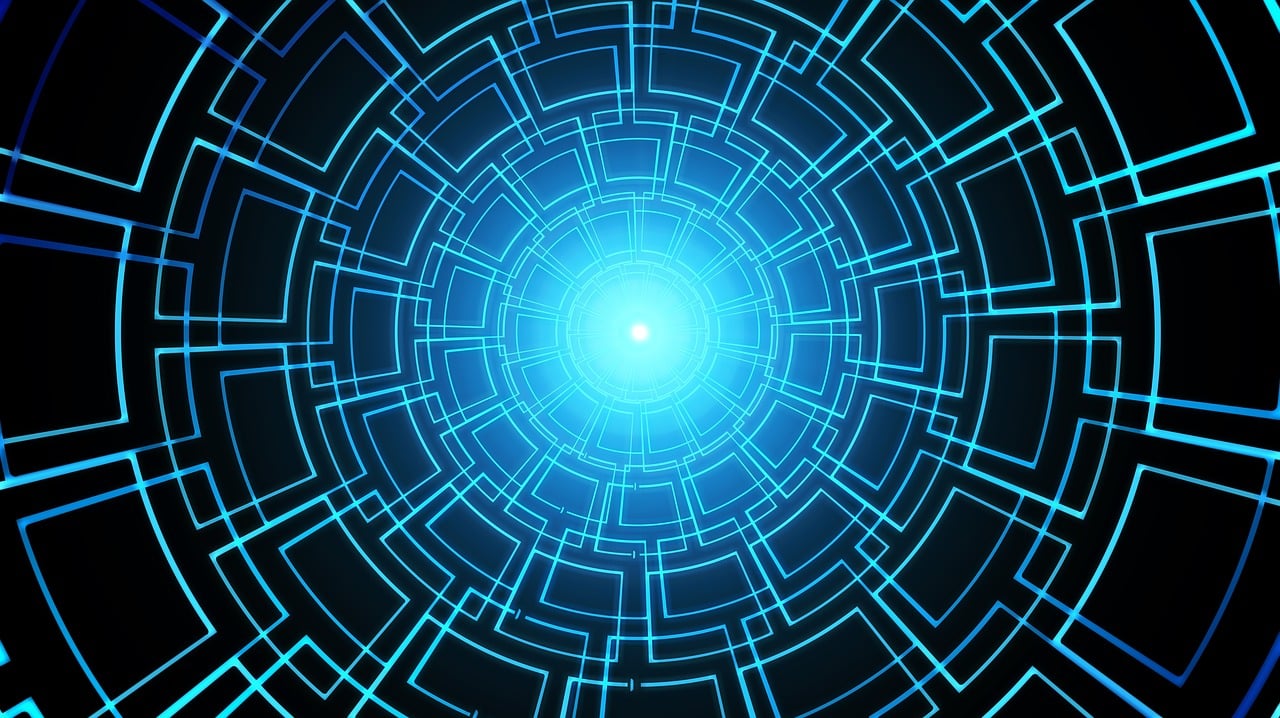
Keine Panik! Alles läuft wieder durch Serverumzug!
Ja, es war hier ein wenig still. Das soll so natürlich nicht sein, wenn man[…]

Europawahl 2024, wir kommen! Parteitag in Lübeck
Es war vorgestern das erste Mal, dass ein Bundesparteitag der PdH in Schleswig-Holstein stattgefunden hat.[…]

Wir brauchen mehr Europa in Europa
Es gibt Kräfte in Europa, die innerhalb der Strukturen der Europäischen Union – ja, ziemlich[…]
Mehr Transparenz
Was in Europa passiert, geht uns alle an. Also sollten auch alle Bürgerinnen und Bürger wissen, was passiert!
Zusammenarbeit fördern
Um die Krisen zu bewältigen, müssen wir wieder lernen besser zusammenzuarbeiten. Ohne Zusammenarbeit gehen wir baden.
Digitalisierung
Das 21. Jahrhundert schreit nach Digitalisierung. Es wird Zeit, dass wir endlich etwas unternehmen!
Meine Ziele für Europa
In Europa passiert mehr als nur die Definition von geraden Gurken und krummen Bananen. Europa ist mehr als nur Regeln und Regulierungen.
Weniger Korruption
Die Arbeit im Europaparlament ist nicht dafür gedacht, sich die eigene Tasche bis zum Rand vollzustopfen.
Gegen den Klimawandel
Es wird nachweislich immer prekärer beim Thema Klimawandel. Wir müssen gemeinsam alles für ein Aufhalten tun!
Wirtschaftliche Erholung
Die letzten Jahre haben allen viel abverlangt. Es muss was getan werden, damit es allen wieder besser geht.
